In Keltengräbern wurden Reste von Kettenhemden gefunden, die in die Zeit um
400 v.u.Z datieren. Die Römer haben sie von den Kelten übernommen und ihren
Bedürfnissen angepaßt. Kettenhemden wurden noch bis 1910 bei pakistanischen
Stammesangehörigen im Kampf getragen. Dies ergibt eine Nutzungsperiode von
über 2300 Jahren.
Kettenhemden nehmen dem Schwert die Schärfe/Spitze und einen Teil der Wucht,
sie sind geschmeidig und passen sich dem jeweiligen Träger an, damit stellen
sie eine geradezu ideale Ausrüstung für große Heere dar, denn sie können in
entsprechender Stückzahl vorgefertigt und ausgegeben werden, ohne dass einzeln
Maßgenommen werden muß.
Ihr Nachteil der großen Oberfläche, die rosten kann, kommt nur bei Lagerung zum
Tragen, wird das Kettenhemd häufig getragen und bewegt, reiben die Ringe aneinander
und der Rost wird weitgehend abgescheuert.
Der große Vorteil gegenüber anderer Panzerung liegt in der einfachen Reparatur,
zu der nur minimal Werkzeug und Material mitzuführen ist und darin, dass zum Ab-
bzw. Ablegen keine Hilfe benötigt wird.
Die meistgebräuchliche Version ist die 4/1 (vier in eins), bei der in jeden Ring
vier weitere Ringe eingehängt sind.

Abb.1 antike Tragweise
Dies ergibt einen Kette-Schuß-Effekt, die Beweglichkeit in den rechtwinklig
Richtungen ist ungleich. In Abb.1 ist die Richtung der stärksten Beweglichkeit
links/rechts. In Abb.2 wäre dies oben/unten, die jedoch beim Tragen durch das
Gewicht des Kettenhemdes stark behindert wird.

Abb.2 im Mittelalter zu findende Tragweise
Typisch für die römischen Kettenhemden war die Verwendung gestanzter Ringe/
Scheiben, die durch Drahtringe miteinander verbunden wurden. Jeder Drahtring
wurde in sich vernietet. Kettenhemden mit gestanzten Ringen sind bei gleicher
Ringgröße dichter.

Abb.3 links nur runde Drahtringe, rechts flache und runde Ringe alternierend
(die Ringe sind nicht vernietet, die flachen Ringe nicht gestanzt)
Bezieht man die Herstellung der Halbprodukte, wie Draht bzw. Eisenpaltten mit
in die Überlegung ein, liegen die Vorteile der Verwendung gestanzter Ringe klar.
Es ist um ein Vielfaches einfacher und schneller aus dem Eisenbarren, dem
Ausgangsmaterial, eine Platte mit einer Stärke von ca. 1 mm zu schmieden, als
einen Draht zu ziehen.
Weitere Vorteile der gestanzten Ringe sind das Fehlen einer Sollbruchstelle,
denn die Materialstärke ist durchgängig gleich, und nach dem Einarbeiten ins
Hemd entfällt die Notwendigkeit des Vernietens der gestanzten Ringe.
Zum Vernieten des Drahtrings wurden die beiden Enden überlappt, flachgehämmert,
ein Loch hineingetrieben, in das ein kleines dreieckiges Stück Metall gesteckt
und am spitzen Ende umgehämmert wurde.
Die Ringgrößen und damit das Gewicht der Kettenhemden variierten von 3 mm
Innendurchmesser bis zu 8 mm Innendurchmesser. Die Spanne des Gewichts reicht
von 7 kg bis 14 kg.
Die römischen Kettenhemden waren weitgeschnitten, wodurch sich Scheinärmel
ergeben, und sie endeten etwa eine Handbreite überm Knie. Bis um die
Zeitenwende hatten die Kettenhemden im Schulter-Nacken-Bereich eine Dopplung,
die mit einem Haken vor der Brust zusammengezogen wurde. Diese entfielen im
Laufe des 1.Jahrhunderts.
Das Kettenhemd war Teil der Standardausrüstung der römischen Legionen, bis zum
Aufkommen der Schienenpanzer in CLAUDISCHER Zeit und wieder nach ihrem
Verschwinden. Bei den Auxiliartruppen hat sich der Schienenpanzer nicht
durchgesetzt, hier war das Kettenhemd durchgängig Standard.
Wir leben nicht in der Antike und haben die bequeme Möglichkeit im Fachhandel
Eisendraht der verschiedensten Stärken mit Längen, von denen die Römer nur
träumen konnten, zu beziehen. Am nächsten an das römische Original kommt
gewöhnlicher Eisendraht. Bei den von mir bevorzugten Ringgrößen mit
Innendurchmesser von 4 mm ist eine Drahtstärke von 1 mm Durchmesser für die
Stabilität ausreichend und gewährt einen hohen Tragekomfort. Die Hemden bestehen
aus ca 75 000 Ringen und wiegen ca 7,5 kg.
Die Ringe werden alle selbst hergestellt. Wie bereits vor 2000 Jahren dient dazu
ein Metallstab, um den der Draht gewickelt wird.
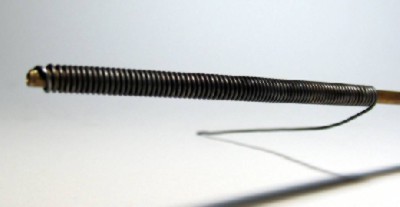
Die so entstandenen Würmchen (Begriff aus dem MA) werden dann der Länge nach
aufgeschnitten und die offenen Ringe sind fertig, sie müssen nur noch zu einem
Kettenhemd zusammengesetzt und zu gebogen werden.

Am besten eignet sich ein Paar leicht modifizierte Flachzangen. In die beiden
Greifbacken jeder Zange werden je zwei Rillenpaare eingeschliffen, je ein Paar
Längsrillen, die verhindern, dass die Ringe beim Zusammendrücken rausspringen,
und je ein Paar Querrillen in Form/Größe der zu bearbeitenden Ringe, die für
einen sicherne Griff der Ringe sorgen.


Es gibt verschiedene Methoden die Ringe aneinander zufügen, jeden Ring einzeln
oder einen geschlossenen mittels eines offenen Ringe ans Gewebe ansetzen. Auch
ist es egal, ob man in Längs- oder Querrichtung arbeitet, da findet jeder nach
einiger Zeit seine Lieblingsrichtung.
Bisher sind alle Ringe nur stumpf zusammengebogen und nicht genietet, auch die
flachen Ringe (Abb.3) sind nicht gestanzt, sondern flachgehämmerte Ringe.
Natürlich wäre kein römischer Soldat mit solchen Hemden in die Schlacht gezogen,
und genauso wenig ziehen wir in Schlachten, dafür sind unsere Waffen zu authentisch
und das Verletzungsrisiko zu groß.
Auch die Frage, ob Kettenhemden bei Feuerwaffen helfen, sei hier kurz
angeschnitten. Sie helfen - aber nur dem, der die Waffe abfeuert! Durch die hohe
Auftreffgeschwindigkeit der Geschosse hat das Kettenhemd keine Zeit sich zu
verformen und so Energie aufzunehmen, vielmehr brechen die Ringe im Bereich der
Einschußstelle und werden mit in die Wunde gerissen. Da ist es günstiger das
Kettenhemd vorher auszuziehen.